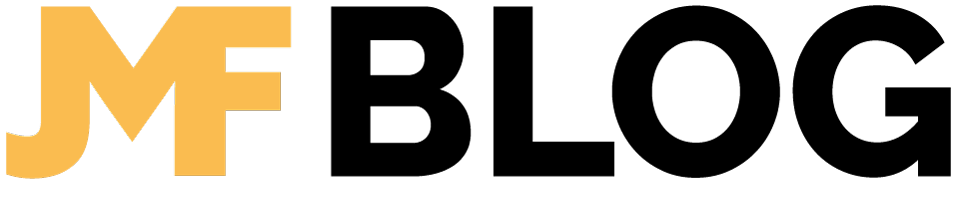Meret Busch
Am Anfang war das Wort. Für eine ziemlich lange Zeit auch nur das mündliche. Dann entwickelte sich vor etwa 6000 Jahren in Mesopotamien, irgendwo zwischen Euphrat und Tigris mit der Keilschrift die erste Lautschrift und ermöglichte erstmals Gesprochenes physisch festzuhalten. Fast 5500 Jahre später beherrschte die Menschheit zwar unzählige Schriften, doch immer noch musste jeder Text mühselig von Hand abgeschrieben werden. Bücher waren demnach teure Luxusgüter und vor allem dem Adel und Klerus vorbehalten. Sowieso konnte sie kaum jemand lesen, denn die Alphabetisierungsrate in Europa lag bei unter 10%.
Revolution durch den Buchdruck
Das alles begann sich schlagartig zu verändern, als Johannes Gutenberg 1450, nach dem technischen Prinzip von dem Chinesen Bi Sheng, den Buchdruck mit beweglichen, metallischen Lettern erfand. Bi Sheng hatte schon 400 Jahre zuvor eine Methode des Buchdrucks mit beweglichen Lettern erprobt, seine Technik konnte sich im Chinesischen Reich jedoch nicht gegenüber einer aufwendigen Holzschnitttechnik durchsetzen. Zuerst wurde die neue Technologie vor allem für kirchliche Schriften, dann während der Reformation um 1500 für Propaganda-Flugschriften mit großen Auflagen genutzt. Durch Luthers Bibelübersetzung, dem aufkommendem Protestantismus mit seiner Rückbesinnung auf das geschriebene Wort und der Vergünstigung von Text-Kopien stieg im 16. Jahrhundert die Lesefähigkeit der Bevölkerung. Um 1600 entstanden schließlich die ersten Wochenzeitungen und lösten die bis dahin vorherrschenden fahrende Sänger und Spielmänner (Barder) als Nachrichtenübermittler ab. Die „Relation“ (1. Ausgabe 1605) aus Straßburg gilt als älteste, bekannte Zeitung und berichtete mithilfe eines internationalen Netzwerkes an Korrespondenten über Ereignisse aus ganz Europa. Ebenfalls in Frankreich, erschien 1665 mit dem „Journal de Sç
avans“ die erste wissenschaftliche Fachzeitschrift und begründete eine neue Gattung der Medien.
Telegrafie verändert Medienlandschaft
Im 19. Jahrhundert folgten die Erfindung der Schnell- und Rotationspresse, Zeitungen wurden größer, dicker und erschienen nun häufiger auch als Tageszeitungen mit täglicher Auflage. Doch die wahrscheinlich größten Erfindungen für die Medien im 19. Jahrhundert geschahen abseits des Zeitungswesens. Mit einer nie dagewesenen Abfolge von weitreichenden technischen Entwicklungen der Kommunikationsmedien wurde in den 1840er die Telegrafie, in den 1870er das Telefon und gegen Ende des Jahrhunderts schließlich der Film erfunden. Filmemacher zogen einige Zeit mit Wanderkinos umher bis sich ortsfeste Filmtheater etablierten. Vor den dort gezeigten Kinofilmen wurden filmische Wochenschauen, sozusagen Frühformen der abendlichen Nachrichtenprogramme, gezeigt. Die rasante Transformation der Medienwelt beschleunigte sich nochmals im 20. Jahrhundert mit der Erfindung des Radios, Farb- und Tonfilm, Fernsehen und dem Internet als zweite Medienrevolution nach Gutenberg. Der erste Radiosender in Deutschland wurde 1923 unter Beteiligung der Reichspost gegründet, doch bis quasi alle Deutschen Haushalte ein eigenes Radio besaßen dauerte es noch 30 Jahre. In den 30er Jahren begannen die Nazis ein regelmäßiges Fernsehprogramm zu senden, welches in öffentlichen Fernsehstuben von der Bevölkerung, die selbst noch keine Empfangsgeräte besaßen, angeschaut werden konnte.
Das Ripl’sche Gesetz
In den 50er Jahren gibt es in der BRD rund 84.000 Fernsehapparate, nur zehn Jahre später sind es jedoch schon mehr als 8 Millionen und das Fernsehen wird zum Massenmedium. Einzelne Sendungen erreichen bis zu 90% der Bevölkerung und werden als „Straßenfeger“ bezeichnet, die zu ihrer Sendezeit das öffentliche Leben lahm legen. Ab 1967 wurde Fernsehen in Farbe gesendet, doch die Senderauswahl war noch sehr gering. Erst 1984 mit der Erfindung von weiteren Übertragungstechnologien, Kabel und Satellit, können sich privatwirtschaftliche Fernsehanstalten etablieren und ein vielfältiges Sendeangebot entsteht.
Für Jahrhunderte galt bei der Entwicklung neuer Medien das Ripl’sche Gesetz, dass neue Medien niemals die schon bestehenden verdrängen, sondern Ergänzungen darstellen. So wurde das Buch nicht vom Radio verdrängt und das Radio nicht vom Fernsehen. Doch die letzte große Medienrevolution, die Erfindung des Internets, scheint zum ersten Mal zumindest Zweifel an der 1913 aufgestellten Maxime zu wecken.
Zeitungsjournalismus in der Krise
Zum ersten Mal können Nachrichten online fast in Echtzeit abgerufen werden, viele von ihnen kostenlos. Quasi jeder, der ein internetfähiges Endgerät besitzt kann über Soziale Medien und anderen Plattformen, wie z.B. Spotify, selbst zum Medienschaffenden werden. Die Medienwelt erlebt eine Demokratisierung. Herkömmliche Zeitungsverlage aber kämpfen mit dem Wandel. Bis zur Etablierung des Internets bezogen sie ihre Finanzierung hauptsächlich aus dem Verkauf von Anzeigeplätzen, doch mit online-Anzeigen erreichen Unternehmen schnell eine deutlich größere Anzahl an Menschen. Die Erlöse aus Anzeigenverkäufe klassischer Medienhäuser brechen ein. Gleichzeitig sinkt vor dem Hintergrund online, kostenlos verfügbarer Nachrichten (trotz oftmals deutlich geringerer Qualität) unter den Lesern aber auch die Bereitschaft für ihre Informationsquelle zu zahlen. Allein von 2012 bis 2019 verzeichneten die Tageszeitungen einen 29 prozentigen Rückgang in der Auflagenzahl.
Besonders Lokalzeitungen leiden unter der wegbrechenden Finanzierung und stellen sich zunehmend multimedial auf. Kleinere Zeitungen werden aufgekauft oder stellen ihr Geschäft ganz ein, die regionale Medienvielfalt sinkt. Das hat schwerwiegende Folgen: Wo lokale Medien aus der Öffentlichkeit verschwinden, wählen die Menschen extremer und engagieren sich seltener. Auch die lokale Politik wird korrupter, macht mehr Schulden und gibt sich ohne die Kontrollinstanz der Lokalzeitungen ganz generell weniger Mühe.
Letzte Zeitung 2034?
2012 berechnete der Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. Klaus Meier, dass die letzte Zeitung 2034 die Druckerei verlässt. Ob Meiers Vorhersage mehr als bloße Untergangs-Rhetorik ist, oder die Zeitung noch ein Revival wie Plattenspieler und Co. Erlebt – Die Zukunft der Medienbranche ist Crossmedial.